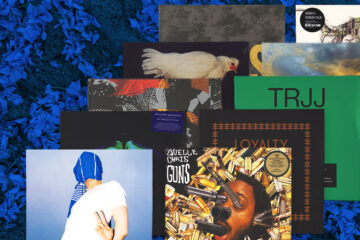Man hat manchmal das Gefühl, dass keine andere Stadt so sehnlich den Frühling herbeisehnt wie Berlin. Es ist Februar, kalte Wochen liegen hinter der Hauptstadt, heute zeigt das Thermometer 15°: direkt recken sich die Köpfe in den Straßen der Sonne entgegen.
Es könnte kaum ein passenderes Setting geben, um mit Eno Williams unterwegs zu sein. Gemeinsam mit Max Grundhard bildet sie den Kopf von Ibibio Sound Machine. Mit einer energetischen Mischung aus Highlife, Afrobeat, Jazz-Einflüssen, Psych und einem unnachahmlichen Gesang in der südnigerianischen Sprache Ibibio produzieren die beiden Musik, die man »Soundtrack des Sommers« nennen würde – wenn man dürfte. Seit dem Erscheinen ihrer ersten, schlicht »Ibibio Sound Machine« betitelten Platte haben die beiden auf Festivals für Furore gesorgt.
Eno Williams, aus Nigeria stammende Engländerin und ihr Partner Max, der aus dem nicht wenig sonnigen Australien stammt, sind freundliche, außerordentlich aufgeschlossene Personen. Das Interview findet in einem hippen Design-Hotel statt, dass dafür bekannt ist, dass viele Musiker und Prominente hier übernachten. Ein kleiner ›Melting Pot‹ inmitten der Hauptstadt. Zufällig saß an diesem Morgen auch Högni Egilsson von Gus Gus in der Hotellobby, spielte Klavier. Williams alles andere als scheu, gesellte sich dazu. Ein unwahrscheinliches Duett.»Es bringt nichts zu trauern, Darling. Umso mehr müssen wir den Verängstigten freundlich gegenübertreten.«
Eno Williams
Das Musizieren mit Menschen verschiedenster Couleur und Herkunft scheint Eno Williams bereits in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Die Band Ibibio Sound Machine besteht aus acht Musikern mit verschiedenen Wurzeln. Aber wie findet man mit solch verschiedenen Biographien in einer Stadt wie London eigentlich zusammen? »Die Stadt ist zwar groß, doch bestimmte Szenen sind recht klein. Zwar leben sehr viele afrikanisch-stämmige Personen in der Stadt, doch die Musikszene, die sich mit der Musik auseinandersetzt … da kennt man sich«, erzählt Grunhard.
Global Pop gegen den Weltmusik-Begriff
Allerdings: afrikanische Musik machen Ibibio Sound Machine keine. Sie lehnen diesen Begriff sogar ab. Diese Ablehnung begründet sich auf zweierlei Weise. Erstens ist Afrika offensichtlich zu groß und zu divergent. Zwischen Westafrikaner und Ostafrikaner, zwischen Zentralafrika und Südafrika, gibt es große kulturelle, sprachliche und auch musikalische Unterschiede. Dazu gesellen sich dann noch die nordafrikanischen und Sahara-Staaten, die noch einmal ganz anders funktionieren. Die Band findet es von daher übergriffig für andere Kulturzonen zu reden.
Wichtiger noch scheint aber eher ein emanzipatorischer Ansatz. Zwar sind innerhalb der letzten Jahre viele Platten afrikanischer Künstler_innen teils äußerst positiv besprochen worden, doch scheinen die Bewertungsmuster anders als bei sogenannter ›normaler‹ westlicher Popmusik. Sowohl Reissues als auch aktuelle Produktion werden auf so etwas wie einen exotischen Wert hin überprüft und daraufhin besprochen. Da möchte Ibibio Sound Machine nicht mehr mitspielen.
Die erste Platte klang noch eher Retro, die »modernen« Momente waren spärlicher gesät. »Uyai« hingegen wird hier mal von einer Acid-Line getrieben, an anderer Stelle gibt es ein Bassfundament, das eindeutig nach englischer Pop-Musik der letzten Jahre klingt. »Global Pop« nennen es die beiden. Doch damit ist eben kein Surrogat für den klugerweise immer seltener genutzten »World Music«-Begriff gemeint, sondern man möchte daraus ein eigenständiges Label machen. Die Vermengung des nigerianischen Ibibio-Sounds mit ghanaischer Musik und vor allen Dingen elektronischen Instrumenten soll einfach als Popmusik anerkannt werden; ohne Herkunftsdiskussion. Wie mühsam es ist, diese ein für allemal fallen zu lassen, zeigt sich beim eben erwähnten Begriff »World Music«: Schon seit den 1980er Jahren hat sich eine Front aus Kritikern, Musikern und Promotern dafür eingesetzt, dass dieser rassistisch konnotierte Begriff eingemottet wird.
Williams und Grundhard kämpfen da gemeinsam gegen die kleinen Rassismen an. Ein Teil ihrer Arbeit äußert sich in genauen Erklärungen zu ihren Ideen bezüglich der neuen Platte.
»Anfangs war mein Gesang, mein Storytelling das, was die Grundlage bildete. Nun haben wir uns aber auch als Band gefunden, was dazu geführt hat, dass wir anders an die Platte gegangen sind. Wir haben alle Ideen zusammengeschmissen – in Nigeria sagen wir auch ›we cooked a pot of stew‹«.Hier soll futuristisch einfach nur heißen
nicht alt.:
Zwar verweist man immer wieder auf kulturelle Eigenheiten und Idiome aus Williams‘ Heimat, doch möchte man das nicht als Besonderheit stehen lassen, sondern eine Normalisierung des »Unnormalisierten«, dessen, was als fremd empfunden wird also, durchführen. So wie das in kosmopolitischen Megastädten wie London, Paris und Berlin schon länger der Fall ist. Man merkt schon bald: Auch wenn die Combo noch jung ist, und man bisher eher ein Underground-Tipp ist, gibt man sich nicht als Underdog, sondern möchte Sprachrohr einer ganzen Bewegung sein.
Nach Gegenwart klingen
»Acts wie wir, oder auch Clap! Clap! aus Italien, sind da Vorreiter.« Auch das Label Black Acre oder Gruppen wie Auntie Flo vermengen ganz nebenbei und natürlich Einflüsse ohne in koloniale Machtlogiken zu verfallen. Ein Ziel ist es, dem afrikanischen Sound neues Leben einzuhauchen, ihn vielleicht sogar in einen Futurismus zu übertragen«, erzählt mir Eno.
All zu leicht möchte man das dann wiederum »Afrofuturismus« nennen. Doch geht es hier weder um eine zukunftsorientierte Vision einer Gesellschaft, die die Afrodiaspora aus der Zeit des sogenannten Black Atlantics, also der Sklaverei- und Kolonialgeschichte, überwunden hat, noch um eine schwarze Utopie wie man sie von den Space-Kolonien Sun Ras kennt, oder der Atlantis-Neuschreibung Drexciyas. Hier soll futuristisch wohl einfach nur heißen: nicht alt.
Man möchte eben nicht mehr retro klingen oder reproduzieren, sondern etwas Eigenes schaffen. Den Vorwurf der Retrolastigkeit, damit muss sich die Popkultur der letzten Jahre im Allgemeinen, und die Reissue-Gemeinde im Speziellen gefallen lassen. Diese wohlkuratierten Labels wie Analog Africa, Strut oder Soundway, die sich auf das Wiederverwerten afrikanischer, südamerikanischer oder karibischer Musik spezialisiert haben. Es ist den beiden und der Rest der Band um eine Gegenwartsbeschreibung gelegen.
Der Hit auf der Platte ist die mittlerweile schon zwei Jahre alte Nummer »The Pot is on Fire«. Es ist auch die erste Singleauskopplung geworden. »Da geht es wieder ums Kochen. Um das Zusammenbringen verschiedener Zutaten. Das kann man als Bild für das Musikmachen sehen oder vielleicht sogar für eine Gesellschaft. Es ist ja meistens am besten, wenn die verschiedenen Einflüsse was Neues schaffen.«