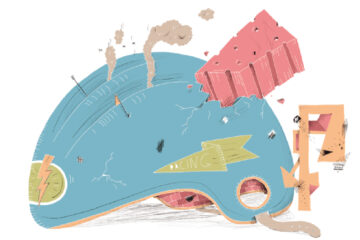Eigentlich war ich immer ein Hüte- und Mützentyp, kein Frisurenmensch. Das hängt mit pubertärer Unsicherheit vor schlecht sitzendem Haar zusammen. Mit der Mütze ist man sicher. Da kennt man den idealen Neigungswinkel zur Kopfachse mit der Zeit. Sitzt, passt und man weiß, was da auf dem eigenen Kopf abgeht. Schief hängende Strähnen, mit dem Abend zerfallende Frisuren, das macht mich ebenso wuschig im Kopf wie es die Haare auf ihm selbst sind. Nur eine Frisur habe ich jahrelang gerne getragen: Mein Dreadlocks. Die saßen auch immer und fielen genau gleich.
Selbstverständlich ist das schon lange her. Als Ende der Neunziger zu viele Hippie-Studenten anfingen sich die Haare zu verknoten, war es aus mit meinem Flusenteppich. Runter mit den Locken!
Bis dahin waren die Dreads die ideale Verkörperung meines Musikgeschmacks und meiner Weltanschauung: Irgendwo zwischen HipHop und Punk. Das EFX hatten Dreads, KRS One auch. Ich färbte meine blond und ließ sie braun nachwachsen, wie Kurt Cobain sein glattes Haar. Damals trug ich außerdem eine dicke, fake Goldkette, mein Punkrockdetektor. Jeder Punk der mich anprollte, »Ey, Goldkette – HipHop oder was?!« outete sich automatisch selbst als spießiger Antipunk. Wer sich von einer Kette provozieren lässt, kann so rebellisch nicht sein.
Wie gesagt, irgendwann gab es zu viele brave Ökos die auch verfilztes Haar trugen. Da war dann meine Grenze erreicht. Also schnitt mir eine Freundin die Haare kurz und freute sich halb angeekelt, diese gleichzeitig auch untersuchen zu können: Innen zu grauem Staub zerfallen, so alt und gammelig waren die nach vier Jahren.
Das bemerkenswerteste einer solchen äußerlichen Radikal-Veränderung sind die antizipierten Umweltreaktionen auf einen selbst. Auf einen Dreadlocktypen wird anders als auf einen gescheitelten reagiert. Und das denkt man mit der Zeit immer auch selber mit. Ich lebte 1997 in Berlin-Friedrichshain. Ich wohnte zwischen Ostkreuz und Frankfurter Allee. Sieht man vom Ring-Center selbst ab, sah die Gegend damals noch genauso aus wie zur Wende: grau und unverputzt.
Wenn ich am Ostkreuz aus der S-Bahn stieg oder im Ring-Center einkaufte, musste ich immer auf Nazi-Glatzen achten. Damals sahen die Nazis noch so aus wie Skinheads, sie waren also leicht und von weitem aus bereits erkennbar. Es brauchte mehrere Wochen, bis ich mich daran gewöhnt hatte, mich an diesen und ähnlichen Orten nicht andauernd umzugucken und auf bedrohliche, rechtsextreme Schlägertypen zu achten. Als Dreadlocktyp war man damals – und ist es wahrscheinlich auch heute noch in gewissen Gegenden – ein genauso rotes Tuch für Nazis wie als Schwarzer oder sonstwie »un-arisch« aussehender Mensch. Aber als Dreadlocktyp kann man sich die Haare schneiden und ist auf einmal undercover: »Ah, die sehen ja gar nicht, wie ich denke!« Wolfgang Schäuble hat mal erzählt, dass er in seinen Träumen immer noch laufender und nicht rollstuhlfahrender Mensch sei. In meinen Träumen hatte ich noch jahrelang Dreadslocks.
Jahre später drehte Quentin Tarantino »Inglorious Basterds« in Babelsberg und suchte Statisten. 2000 Leute und mehr standen Schlange. So reizvoll die Aussicht war, sich selber in einem Taratino-Streifen zu sehen, so wenig Lust hatte ich natürlich auf stundenlanges Anstehen. Mein Bruder wusste Abhilfe. Eine Freundin von ihm gehörte zum Casting-Team. Wir machten einen Termin.» Wolfgang Schäuble hat mal erzählt, dass er in seinen Träumen immer noch laufender und nicht rollstuhlfahrender Mensch sei. In meinen Träumen hatte ich noch jahrelang Dreadslocks. «
Um ganz sicher zu gehen, auch wirklich genommen zu werden, musste ich mich optisch vorbereiten, nichts dem Zufall oder der Tagesform überlassen. Man wusste, dass der Film im Dritten Reich spielt. Also ging ich zum türkischen Friseur in meiner Kreuzberger Nachbarschaft, der eigentlich Tunesier ist, aber türkisch spricht, Ali heißt und den Laden vom älteren, türkischen Ali übernommen hat. Das habe ich alles erst hinterher erfahren, damals kannten wir uns noch nicht.
Ich ging also zum ersten Mal in den Laden und Ali fragte mich wie er mir die Haare schneiden solle. Ich sagte ihm: »Mach mir eine Nazi-Frisur!«
Ali guckte mich befremdet, vielleicht auch schockiert an.
»Nein, nicht Skinhead, Mann, mehr so 30er Jahre, weißt du? An den Seiten und hinten ausrasiert und oben ein nach Hinten gegelter Scheitel. Quentin Tarantino dreht in Berlin einen Film über Nazi-Deutschland.«
»Ach so, alles klar«, sagte Ali und ließ den Trimmer aufheulen.
Als ich zwei Monate später oder so wieder zu ihm ging, fragte er mich mit freudiger Neugierde, ob ich den Job gekriegt hätte. Hatte ich nicht. Die Caster waren der Meinung, ich sähe nicht deutsch genug aus. »Vielleicht kannst du am Ende, wenn das Kino in die Luft geht einen Franzosen geben.« Da ist allerdings auch nichts draus geworden.
Aber ich bin irgendwie bei der Frisur geblieben. Ali fragt mich seitdem jedesmal, »Nazifrisur?«, wenn ich zu ihm gehe.
Und ich sage dann immer: »Auf jeden!«
So ist das mit der Distinktion, man muss sich immer ein bißchen absetzen vom Rest. Im Ernst, wenn die lieben Ökos mir meine alte Frisur verleiden und die widerlichen Nazis heute rumlaufen wie die autonome Antifa in den Neunzigern, dann darf ich doch wohl bitte deren Oldschool-Frise okkupieren!