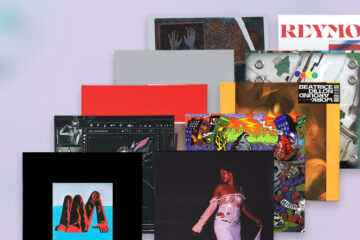Wenn es »Gegen den Kopf stoßen« zu definieren gilt, dann könnte diese Definition gut und gerne einfach Squarepusher heißen. Das fing bereits 1997 mit »Hard Normal Daddy« an, als Squarepusher-Fans aus der Zeit bei Spymania und Rephlex Records in Hasstiraden ausbrachen, weil der harte Drum & Bass den jazzigem Melodien gewichen war. In den Folgejahren wurde dann aus jazzigem Drum & Bass echter Jazz, Amen-Break Drill & Bass, Soundexperiment am 5-Seiten-Bass, elektronischer Punk Rock und schlussendlich poppiger 80s Prog Rock. Das war zutiefst erklärungsbedürftig. So manche Anhänger wurden da auf der Strecke gelassen. Tom Jenkinson, dem Mann hinter Squarepusher, war das aber herzlich egal. Seine Kommunikation zu den jeweiligen Alben war entweder sehr begrenzt oder verwirrend. Und selbst nach 17 Jahren im Musikgeschäft gibt er sich schwer mit Interviews. Der englische Musiker und enfant terrible würde seinen Ansatz nicht einmal als »Gegen den Kopf stoßen« bezeichnen. Für ihn ist es eher der Versuch, selbst in Bewegung zu bleiben und Sackgassen fern zu bleiben. Sein 13. Album »Ufabulum« schlägt das nächste Kapitel in dieser lebenslangen Auseinandersetzung auf. Es verspricht erneut, was die meisten Musikveröffentlichungen dieser Tage längst verlernt haben: Entdeckungen, Identitätswechsel und Diskurs. Wir haben Tom Jenkinson gebeten, den kleinsten gemeinsamen Nenner von Squarepusher zu verraten. Und die Antwort war eigentlich ganz einfach: es gibt keinen.
Die erste Ankündigung zum Album war, dass es sehr melodisch und sehr aggressiv wird. Diese Kombination scheint dich zu interessieren. Sollen die Melodien die Aggression besänftigen, sie zugänglicher für den Hörer machen?
Tom Jenkinson: Hauptsächlich ist diese Zusammenfassung für das Marketing der Platte sinnvoll. Es ist ein Zugeständnis, das ich hasse zu machen. Aber ich sehe es pragmatisch. Ich gebe diese mehrdeutige Beschreibung meines Albums nur, damit es niemand anderes macht. Denn dann wird es noch schlechter. Und meine Erfahrungen haben mich gelehrt, dass es unmöglich ist, diese Art catchy storyline zu vermeiden. Wenn ich es nicht mache oder wenn Warp Records es nicht machen, dann macht es irgendein Wichser im Internet oder ein Journalist oder wer auch immer.
Du hast dich – im Vergleich zu früher – mit deinen letzten Alben kommunikativ geöffnet. Diese waren immer mit Beschreibungen, Interviews und persönlichen Anmerkungen bestückt. Hat die Zusammenarbeit mit anderen Musikern (insbesondere deinem Drummer Alex Thomas) – also das Öffnen des kreativen Prozesses – auch die Wahrnehmung deiner selbst und deiner Arbeit verändert?
Tom Jenkinson: Der Hauptantrieb war die Realisierung, dass der Musikkommentar das Vakuum verabscheut. Wenn ich also nicht rede, spekulieren andere darüber. Und wenn es häufig genug wiederholt wird, wird es irgendwann als die jeweilig wahrhafte Weisheit zum Thema wahrgenommen. Bei der Musik scheint die »Wahrheit« ein leidiges Thema zu sein. Ich habe über die letzten Jahre auf dieses Problem in unterschiedlicher Weise reagiert. Angefangen habe ich mit der Überlegung, nicht die Wahrheit zu sagen. Wozu auch, wenn die Musikpresse sich nicht um Genauigkeit schert und der Spekulation und Übertreibung den Vorrang lässt.
Aber du hast diesen Ansatz dann nicht nachverfolgt…?»Wenn ich also nicht rede, spekulieren andere darüber. Und wenn es häufig genug wiederholt wird, wird es irgendwann als die jeweilig wahrhafte Weisheit zum Thema wahrgenommen.«
Tom Jenkinson
Tom Jenkinson: Dieser Ansatz ging halt in dem Moment schief, als ich anfing, mein Image und meine Persönlichkeit in den Medien völlig unverständlich zu machen. Ich hatte die eitle Hoffnung, ich wäre zu chaotisch, um begriffen zu werden. So dass weniger Aufmerksamkeit auf mir und mehr auf meiner Musik liegen würde. Ich schwankte zwischen gar keinen Interviews und Interviews, in denen ich die Leute verärgerte oder völlig verwirrte. 2006 habe ich mich dann um 180 Grad gedreht. Ich sprach sehr vorsichtig und faktisch, woraus wahrscheinlich eine Menge sehr langweiliger Interviews entstanden sind. Heutzutage interessiert mich das alles nicht mehr sonderlich. Ich bin stärker überzeugt, meine Musik für sich selbst sprechen zu lassen. Deshalb versuche ich – endlich – wie mit Freunden zu reden. Aber im Angesicht der Öffentlichkeit entpuppt sich das selten also so geradlinig.
In einem Interview mit dem Creator’s Project hast du kürzlich Musik als Klang mit Intention definiert…
Tom Jenkinson: Hmmm. Vielleicht würde ich eher sagen, Musik ist der Rahmen, den wir auf die Welt des Klangs setzen. Der Rahmen verschiebt sich, kontrahiert, verändert die Form. Das meiste, was Musiker machen, kommt durch das Umdenken von Angewohnheiten und vererbten Gesten. Und meiner Meinung nach sind ein Großteil unserer Reaktionen auf Musik historisch vererbt. Ich denke, über Intentionen zu reden, ist Unsinn, insbesondere in der Welt der elektronischen Musik. Vielleicht sollte ich ein paar Intentionen fabrizieren, um das Vakuum zu füllen, bevor es mit Spekulationen gefüllt wird? Nein, diesmal nicht.
Du hast Musik auch als eine Kombination aus Ziffern bezeichnet.
Tom Jenkinson: Ich würde behaupten, du kannst Musik numerisch denken und analysieren. Obwohl Mathematik allein kein ausreichender Rahmen für Musik ist, denn dann könnte das »interpretative« Element nicht ausreichend quantifiziert werden. Und ich habe immer die Idee gemocht, dass Kunstwerke reich an »interpretativem Potential« sind und zugleich immun gegen eine »definitive« Interpretation. Ich versuche, das empirisch umzusetzen, um zu sehen, was Musik am Leben erhält. Was neues Publikum heranzieht, mit neuen Ideen darüber, was es bedeutet oder gar, was es ist. Daher ist mir auch egal, wenn ein Album von mir einfach verschwindet. Denn wenn es passiert, könnte ein sehr wichtiger Grund sein, dass es kein »interpretatives Potential« hatte – also schlicht niemandem etwas bedeutet hat.
Und welche Lehren hast du daraus gezogen?»Ich mag subtilen Humor, diesen fast undurchdringlichen Humor, wenn ein Witz schon gar nicht mehr lustig ist.«
Tom Jenkinson
Tom Jenkinson: Ich sage, wo auch immer Musik ist, sind Quantitäten und bestimmte Verhältnisse, welche diese beherrschen. Und Musiker müssen das für sich wissen. Je weniger du darüber Bescheid weißt, desto weniger bist du Meister deiner Instrumente. Und desto mehr Kontrolle übergibst du an andere Leute (wie den Instrumentenbauer, Toningenieur, Soundkarten-Designer, Lautsprecher-Hersteller, Techniker und so weiter). Aber natürlich hören die Leute nicht Musik, um ständig an Klanganalogien zu numerischen Verhältnissen zu denken. Aber zumindest finde ich es sinnvoll und verständlich, so über Musik zu reden – in der Art, wie es Bullshit, wie »soul« und »feel« und »warmth« nicht ist.
2002 hast du in einem Text, den jemand einmal das »Manifesto« nannte, deklariert, man dürfe keinen Standpunkt haben. Man dürfe nicht schauen, wo man steht, sondern wo man nicht steht. Gleichzeitig sprachst du von einer »vererbten Grundeinstellung«, welche man als Kernwahrheit nehmen sollte, um diese dann bis zum Maximum verzerren zu können.
Tom Jenkinson: Ich hatte immer eine Tendenz dazu, Leute zu verarschen. Es ist im normalen Leben einfach und lustig, aber in der Musikwelt wird es kompliziert. Ich mag subtilen Humor, diesen fast undurchdringlichen Humor, wenn ein Witz schon gar nicht mehr lustig ist. Und ich muss zugeben, manchmal finde ich es sehr unterhaltsam, gute und schlechte Ideen miteinander zu vermixen.
Um ganz ehrlich zu sein, dieses Schriftstück stammt aus einer Zeit, wo ich die Idioten der Musikmedien satt hatte. Wie ich schon zu Anfang meinte, ich ging durch verschiedenen Phasen meiner Öffentlichkeitswahrnehmung. An diesem bestimmten Punkt betrachtete ich die Situation mit tiefer Verachtung. Ich versuchte dennoch, den Text subtil zu gestalten, gute Ideen mit übertriebenem Nonsens zu vermischen. Das habe ich damals mehrfach gemacht.
Dennoch ist die Idee, keinen Standpunkt zu haben, keine feste Definition von sich selbst zu haben, interessant. Sie würde dich quasi zu Gott machen. Das würde einigen wohl als anstößig betrachten.
Tom Jenkinson: Naja, ich habe versucht, die Leute zu verarschen. Und was könnte anstößiger und beleidigender sein als das?