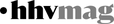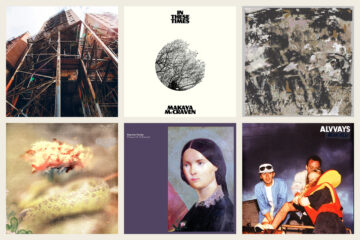Als er etwa fünf Jahre alt war, versuchte seine in einer Nazi-Uniform gekleidete Klavierlehrerin, William Basinski umzubringen. Sie wollte den im Bett liegenden Jungen mit einem Motorrad überfahren. Nicht nur einmal: Die Szene, getaucht in Sepia, wiederholte sich wieder und wieder, Nacht für Nacht.
Basinski berichtete mir während eines Interviews im Jahr 2019 von diesem wiederkehrenden Albtraum auf die Frage nach seiner ersten Erinnerung. Die Szene schien alles zu verkörpern, worum sich sein Werk seit seinem Debütalbum shortwavemusic von 1998 auf noton dreht: Es ist von Erinnerungen durchdrungen, geleitet von Traumlogik – ständig wiederholen sich die Dinge, immer ein bisschen anders. Abwandlungen, keine Auswege.
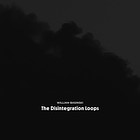
The Disintegration Loops Arcadia Archive Black Vinyl Edition
Basinski ist ein aufgekratzter Dandy, ein glamouröser Punk. Selbstverständlich scheint das nicht, stehen seine Soloalben doch in krassem Gegensatz zu der Person, die sie produziert. Wie kann jemand diese traurige, langsame Ambient-Drone-Musik machen und zugleich so fröhlich und optimistisch sein? Womöglich, weil er schon früh vom Tod träumte und sich mit der Melancholie abgefunden hat.
Niemals endende Trauer
In seinem Werk »Trauer und Melancholie« aus dem Jahr 1917 skizziert Sigmund Freud zwei Arten des Umgangs mit Verlust. Trauer sei ein bewusster, endlicher Prozess: Eine Person akzeptiert den Verlust und macht ihren Frieden damit. Melancholie hingegen beschreibt er als eine Art unerbittlichen Kummer, der auf keinen bestimmten Mangel zurückzuführen ist – ein Gefühl, so hartnäckig und tiefschürfend, doch so vage, dass es Menschen in den Wahnsinn treibt.
Es ließe sich einwenden, dass Freud Unrecht hatte, und dass auch Trauer kein Prozess ist, der jemals abgeschlossen werden kann. Und dass das etwas Schönes ist. Der Name Jacques Derrida wird häufiger in Essays erwähnt, die sich mit The Disintegration Loops befassen – meist jedoch nur indirekt. Für viele ist dasAlbum ein Beispiel für hauntology, ein Begriff, den Derrida geprägt hat und den Mark Fisher auf Musik wie die von Basinski angewandt hat.
Während des Digitalisierungsprozesses begann das Tape sich weiter aufzulösen. Dann traf das erste Flugzeug den Nordturm des World Trade Centers.
Es ließe sich einwenden, dass Fisher nicht verstanden hatte, worum es Derrida, den er einmal als »frustrierenden Denker« bezeichnet hatte, eigentlich ging. Fishers Vorstellung von hauntology beruhte auf der Idee, dass die Musik von The Caretaker, Basinski und anderen von einer »überwältigenden Melancholie« geprägt sei, einer hartnäckigen und tiefschürfenden, doch vagen Sehnsucht nach »verlorenen Zukünften«. Derridas hauntology baut indes auf dem Freudschen Konzept der Trauerarbeit, nicht der Melancholie auf.
Trauerarbeit nach Derrida ist eine Art Mischung aus Trauer und Melancholie – ein unendlicher Prozess des Klarkommens mit einem Verlust, der nie überkommen werden kann. So bleiben die Toten in den Köpfen der Zeug:innen ihrer Existenz am Leben. Es liegt Trost in dem Gedanken, sich so mit Melancholie abzufinden. Basinski kann in diesem Sinne als Trauerarbeiter verstanden werden. »In der Weltkultur und -politik durchlaufen wir immer noch ›The Disintegration Loops‹«, sagte er 2019.
Vom Überschwang in die Trauerarbeit
Im September 2001 begann William Basinski damit, die Tape-Loops mit verlangsamten Aufnahmen von Muzak zu digitalisieren, die er zwanzig Jahre zuvor aus dem Äther gesogen hatte, bevor er sie an einem Baum in seinem Loft in Brooklyn aufhängte und jahrelang nicht anrührte. Die Bänder hatten angefangen zu oxidieren, zersetzt vom Verstreichen der Zeit. Während des Digitalisierungsprozesses begann das Tape sich weiter aufzulösen. Dann traf das erste Flugzeug den Nordturm des World Trade Centers.
Nachdem er am Morgen des 11. September die Digitalisierung der Tonbänder abgeschlossen hatte, beobachtete Basinski vom anderen Ufer des East River aus den Einsturz der Twin Towers. Irgendwann begann er, das Geschehen zu filmen. Am 12. September unterlegte er das Video mit »dlp 1.1«, dem mit 63 Minuten längsten Stück auf The Disintegration Loops. Es war kaum mehr als eine intuitive Entscheidung, die in diesem Moment irgendwie Sinn ergab. Sie tut es heute noch.
Muzak sollte ursprünglich Arbeiter:innen stimulieren und Ruhe simulieren, was es zum perfekten Begleitsound des Kapitalismus im 20. Jahrhundert machte.
Die Musik auf The Disintegration Loops bewegt sich langsam, wie von Traumlogik geleitet. Abgesehen von gelegentlichen Hall-Effekten fängt sie weitgehend dokumentarisch den langsamen Verfall einer Musikrichtung ein, die niemand bewusst hört und die dennoch in den 1970er-Jahren in New York allgegenwärtig war. Muzak sollte ursprünglich Arbeiter:innen stimulieren und Ruhe simulieren, was es zum perfekten Begleitsound des Kapitalismus im 20. Jahrhundert, vielleicht sogar des American Dream machte.
Dieser Traum hatte durch das Ende des Kalten Krieges und den Zusammenbruch des Sozialismus neuen Auftrieb erhalten. Aber am 11. September 2001 endete das 1989 großspurig von Francis Fukuyama verkündete »Ende der Geschichte«, und mit ihm eine Ära, die der Ökonom Alan Greenspan als eine des »irrationalen Überschwangs« bezeichnet hatte. Es war in mehr als einer Hinsicht ein Tod – kulturell, sozial und politisch markierte er das Ende von etwas, das viele für endlos gehalten hatten.
Im Moment dieses Todes entstanden die Disintegration Loops und markierten den Beginn einer Trauerarbeit. Basinski veröffentlichte das Album im Jahr 2002 über das Label 2062, das er zusammen mit seinem Partner James Elaine betreibt. Seitdem hat es ein Eigenleben entwickelt, selbst Orchester führten die Stücke unter anderem am Ground Zero auf. Obwohl es zufällig entstand, wird es als ein definitives Meisterwerk des 21. Jahrhunderts gefeiert. Warum?
Sterbende Musik, lebendige Erinnerung
So viel auch über The Disintegration Loops geschrieben worden ist: Es lässt sich mit Worten nur schwer vermitteln, was genau diesem Album seine Größe verleiht. Letztlich sind es ja doch nur relativ kurze, verlangsamte Fahrstuhlmusik-Loops. Obwohl die an und für sich durchaus schön sind, fasziniert an ihnen jedoch vor allem eins: Ihr sehr realer und greifbarer Kampf um das eigene Überleben.
Kein Stück macht das so dringlich hörbar wie »dlp 1.1«. Im Laufe der 63 Minuten beginnt die Musik zunehmend zu zerfasern, bis der simple Rhythmus und das hymnische Blechbläsermotiv, das mit jeder neuen Wiederholung mehr und mehr wie ein wortloses Heulen klingt, von der Stille verschluckt zu werden drohen. Die Percussion verwandelt sich in bloßes Knacksen, die Stimmen der einzelnen Instrumente verlieren sich in der Luft. Doch dann, kurz nach der 53-Minuten-Marke, kehrt die Musik zurück.
Das Stückt gewinnt die Schlacht nicht, wohl aber den Krieg gegen das Vergessen.
Das Stück klingt nunmehr anders als zu seinem Beginn, es ist reduziert auf seine Grundelemente. Und doch schreitet es ebenso langsam wie anmutig seinem eigenen Tod entgegen. Es ist, als würde »dlp 1.1« in diesen letzten Minuten all seine verbleibenden Kräfte mobilisieren, um ein letztes Mal gegen das Unvermeidliche anzukämpfen. Es gewinnt diese Schlacht nicht, wohl aber den Krieg gegen das Vergessen. Es existiert noch immer in den Köpfen der Zeug:innen von damals, hält die Erinnerung lebendig.
So klingt die Schönheit, die darin liegt, eben nicht zu vergessen und weiterzumachen, sondern die Katastrophe immer wieder zu durchleben, als wäre sie ein besonders grausamer, wiederkehrender Albtraum. Als Basinski mir gegenüber 2019 sagte, dass »das Werk über den 11. September hinaus Relevanz hat«, tat er das ohne Arroganz. Sind The Disintegration Loops doch genau deshalb bis heute wichtig geblieben.
Auf den 11. September folgten Krieg und zunehmende politische Instabilität fast überall auf der Welt. Viele geopolitische und soziale Konflikte von heute lassen sich in irgendeiner Weise darauf zurückführen. Als die ganze Welt mit Gewalt einen Schlussstrich ziehen wollte, lieferte Basinski mehr oder weniger zufällig den Soundtrack zur notwendigen Trauerarbeit.