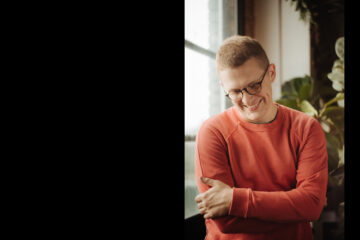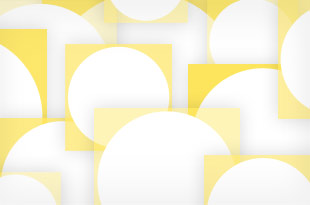Wenn Stefan Burnett auf die Bühne tritt, so fordert er von seinem Publikum eine Entscheidung und fordert diese mit einer Wucht und Härte, die kein Zögern zulässt: Wegbleiben oder Eintreten. Wo die Musik der Kalifornier ein Reichtum an Referenzen zwischen David Bowie und Charles Manson bietet, wo in den letzten Wochen vor allem wegen der kostenlosen Veröffentlichung ihres zweiten Albums, für das sie eigentlich bei Epic Records unterschrieben hatten, über Authentizität und Werbewirksamkeit der Aktion diskutiert wurde, wo ein erigierter Penis ihres Album-Artworks schnell als Meme im Netz aufstieg, ist all das binnen Sekunden weggewischt. Stefan Burnett betritt die Bühne, das Mikrofon eng umfasst wie das eben zitierte männliche Glied ihres Covers, und fordert eine absolute Körperlichkeit, will permanente Vergewisserung von Lebendigkeit, erkämpft sich für eine knappe Stunde vollkommene entgrenzte Hingabe, einem epileptischen Anfall gleich, der keine entlastenden Momente kennt. Death Grips liefern im Festsaal Kreuzberg eine Performance, bei der jeder einzelne auf sich selbst zurückgeworfen scheint. Eher irritierend verläuft da die kollektive Entladung im Moshpit – das Befremdliche hier ist, dass die zwischenmenschliche Reibung, kollektives sexuelles Erfahren, bei einer egozentrischen Masturbation vom Typ MC Ride nicht gefragt ist und so vergeblich um Erfüllung ringt. Und so hat der Sprung von der Bühne an diesem Abend immer wieder, und nicht nur aufgrund des nicht vollständig gefüllten Saales, eine schale und wenig heroische Note. Wie ausgekotzt und benutzt steht die Menge da, als nach einem abrupten Ende und ohne Zugabe das Licht wieder angeht. Man kann sich dieser Musik entziehen, man kann sich zurückziehen, sich an den vorgetragenen Referenzen ergötzen, den kalkulierten Ausbruch analysieren, die Musik fassbar in ihrer Äußerlichkeit machen. Wenn man sich aber einlässt, dann gibt man bei dieser Band immer auch seinen Körper, verläuft die Grenze des Ausbruchs immer eng am kurzzeitigen Einbüßen der eigenen Integrität. Dies kann sowohl orgastisch wie verstörend wirken. Es ist ein Drahtseilakt zwischen Sich-Entziehen und Hinweggerissen-Werden. Hier und nicht zwischen Grime, Punk, Hardcore und Hip Hop verläuft die Grenze, die Death Grips aufmachen. An dieser Grenze zu balancieren und ihre Abgründigkeit tief auszukosten sind sie angetreten und haben es dabei zur Virtuosität gebracht.

Records Revisited: Dizzee Rascal – Boy In Da Corner (2003)
Kolumne