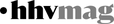Schon blöd, wenn man einen Begriff wie »Boogaloo« nicht mehr verwenden kann, ohne darauf hinzuweisen, dass es nicht um Rechtsextremismus geht. Denn in den USA organisieren sich inzwischen militante Personen ausgerechnet unter der Bezeichnung »Boogaloo-Bewegung« – ein schamloser Fall von kultureller Aneignung. In diesem Text hingegen meint Boogaloo bloß den Rhythmus eines Stücks, das zu aller bitteren Ironie auch noch The Free Slave heißt.
Der Schlagzeuger Roy Brooks spielte es 1970 mit seinen Mitstreitern bei einem Konzert in Baltimore; zwei Jahre später ging daraus ein Live-Album hervor, benannt nach genau dieser Nummer – einem Boogaloo, der um einiges wilder swingt als etwa das längst zum Standard geadelte The Sidewinder von Lee Morgan.
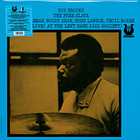
The Free Slave
Dass Roy Brooks’ Stück so unbändige Kräfte entfaltet, hat vor allem mit seinem eigenen Spiel zu tun. Brooks, der mit so unterschiedlichen Größen des Jazz wie Horace Silver, Chet Baker und Pharoah Sanders zusammengearbeitet hat, war ein Musiker, der die Möglichkeiten seines Instruments mit Witz auszureizen wusste. Hier bricht er immer wieder aus der eigentlichen Struktur des Rhythmus aus und erweitert sie um polyrhythmische Akzente. Während sein Bassist Cecil McBee und Hugh Lawson am Klavier reduziert-ostinate Figuren spielen, dreht der Bandleader nach und nach immer mehr auf, ohne völlig aus der Form zu fallen. Dazu heizen der Trompeter Woody Shaw und der Saxofonist George Coleman die Sache durch einen angeregten Dialog untereinander zusätzlich an. Man möchte am liebsten aufspringen. Und etwas lostreten: Einen Tanz – die Revolution.
The Free Slave versammelt vier längere Stücke. Am ruhigsten geraten ist das kontemplative »The Understanding«, das als Kontrast auf das Titelstück folgt und dessen einvernehmliches Räsonieren der Bläser lediglich gegen Ende mit energischen Gongschlägen von Brooks aufgelockert wird. In der zweiten Hälfte des Albums treibt er seine Band dann wieder zu kontrollierten Eruptionen an.
Eine heftig inspirierte Zeit – und eine heftige
Roy Brooks wurde 1938 in Detroit geboren, dort gehörte später unter anderem Yusef Lateef zu seinen Mentoren. In den sechziger Jahren lebte Brooks in New York; wo er neben den oben genannten Künstlern unter anderem auch mit Lee Morgan oder Charles Mingus spielte. Im folgenden Jahrzehnt fiel er zunehmend durch erratisches Verhalten auf und musste häufig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Mitte der Siebziger verließ er New York und zog zurück nach Detroit, wo er zunächst weiterhin regelmäßig musizierte.
Sein Leidensweg war mit dem Rückzug in die Heimat allerdings nicht beendet. Als es in den 1990er-Jahren um den Detroiter Jazz plötzlich nicht mehr so gut stand, verschlechterte sich auch Brooks’ Gesundheit. Weil er mitunter Nachbarn mit Waffen bedrohte, stand er wiederholt vor Gericht. Die letzten Jahre bis zu seinem Tod verbrachte er zum Teil im Gefängnis und starb 2005 nach einem Jahr in einem Pflegeheim.
Freiheit und Harmonie im traditionellen Verständnis gehen bei Brooks unbeirrt Hand in Hand.
Sein Album The Free Slave lässt von dieser harten Biografie selbstverständlich nichts vorausahnen. Diese Musik behauptet sich so entschlossen wie souverän selbst – eine Feier anarchischer Lebensenergie ohne den krassen Formbruch des Free Jazz. Freiheit und Harmonie im traditionellen Verständnis gehen bei Brooks unbeirrt Hand in Hand.
Seine Fähigkeiten als Solist demonstriert Roy Brooks übrigens ausgiebig auf dem Stück »Will Pan’s Walk«. Die komplexe Struktur auf Basis eines Blues-Schemas nutzt er für seine Soli so, dass sie nicht wie das angeberische Zurschaustellen der eigenen Fähigkeiten wirken, sondern die Energie des Stücks einfach vorübergehend in seinen Trommeln und Becken verdichten. An den Zwischenrufen – ob sie nun aus dem Publikum oder von den Musiker:innen selbst stammen – merkt man, dass die an diesem Konzert Beteiligten eine heftig inspirierte Zeit hatten.
So kann Freiheit klingen. Man kann sie, 55 Jahre nach Entstehen der Aufnahme und 20 Jahre nach Brooks’ Tod, immer noch sehr gut gebrauchen.