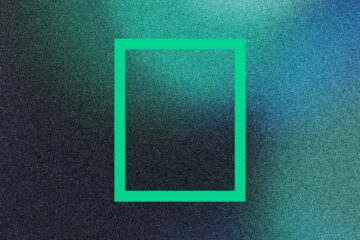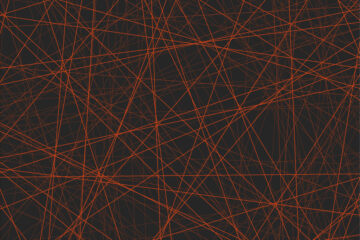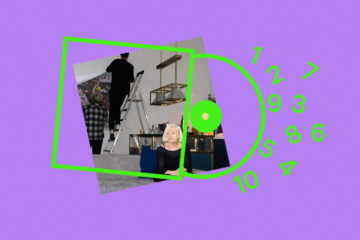Gegen Mitte, Ende der 1990er Jahre erreichte Deutschraps Goldene Ära ihren Zenit. Hip-Hop hatte die Sprache, den Sound und die Mode einer ganzen Generation geprägt. Man war derbe am Start, hat das Mic fett gerockt, und allerorten wurde geflasht. In Berlin allerdings wurde gefickt. Die Gegner am Mic, deren Mütter, verbal. In der Hauptstadt pflegte man einen Rap, der sich gegen Hip Hops hermetisches Wertesystem stellte, der mit etablierten Traditionen brach, die szeneinternen Gesetze ignorierte, sie bewusst überschritt – und schließlich umkrempelte, reformierte und breitentauglich machte. Der Paradigmenwechsel vollzog sich schneller als der durchschnittliche Doppelreim gekickt wurde. Zuallererst über die Sprache, natürlich. Es geht ja um Rap. Er vollzog sich aber auch in den anderen Facetten, die Hip-Hop als subkulturelles Phänomen ausmachten. Beziehungsweise, um es mit Kool Savas zu sagen: »Rap will mehr als SP12 und S900-Imagepflege«.
Im Grunde war deutscher Rap da eben erst salonfähig geworden. Und schon trat Kool Savas ihm in den Arsch. Alleine oder als Mitglied von M.O.R. und Westberlin Maskulin. Was rückblickend betrachtet ein starkes Stück war, hatte Deutschrap doch damals die Existenz seines Arsches fast komplett ignoriert. Rap, als Musikform seit jeher eine körperliche Angelegenheit, drehte sich hierzulande eher im Kreis seiner ständig beschworenen Styles und Skills. Als szeneinternes Zirkeltraining, dessen artistische Stationen sich irgendwo zwischen Doppelreimen, Downbeats und DJ-Cuts eingegroovt hatten. Der revolutionäre Spirit von einst war zum normativen Regelwerk geraten. Es beherrschte die Ästhetik seiner Aktivisten, den Sound ihrer Musik, den Klang ihrer Worte. Und auch, wenn das in seinen Ausprägungen recht vielgestaltig war: Es herrschte Ruhe.
Und dann kommt dieser Typ und beleidigt mal eben einfach so die Altvorderen. »Cool«, sagten die einen, »Sakrileg«, die anderen – und daraufhin bald nichts mehr. Denn was folgte, war ein Sturm. Losgetreten von einem Kerl, der nicht zwischen unflätig und geistreich trennen wollte. Vom selbsterklärten Pimp-Legionär, plump und scharfzüngig zugleich, angriffslustig und hungrig, mit Skills und Ideen. Er war nicht der erste und einzige, der Raps Blaupause schwarzmalte, das nostalgische Element der Bewegung als restriktive Vereinsmeierei enttarnte und die grauen Strähnen der B-Boy-Romantik offenlegte. Aber die Art und Weise, mit der er die Cypher stürmte, legte die Saat für eine Trendwende. Auf einem Feld, wo bald auch andere reiche Ernten einfuhren.Was folgte, war ein Sturm. Losgetreten von einem Kerl, der nicht zwischen unflätig und geistreich trennen wollte.
Die Antihaltung, mit der Kool Savas der Szene entgegentrat, war im Grunde eine inklusive. Sein Rap war zwar aggressiv und negativ gepolt, stellte sich aber bewusst gegen die Exklusivität, die Deutschraps Gralshüter predigten, gegen das Realness-Anspruchsdenken und den daran geknüpften Szene-Snobismus. Rap als schnell konsumierbare Kunstform, als Musik, die gut und gerne auf einfache Reize setzt, sich dabei keiner Genossenschaft verpflichtet sieht, die nichtfestgelegte Hörer erreicht und ihnen vielleicht das bietet, was sie auch vom US-Rap kennen und erwarten: So wollte ihn Kool Savas, so wollten ihn bald alle. Der Rest? Ist Geschichte. Und wird noch geschrieben.
Viele der Geschichten, die in diesem Zusammenhang relevant sind, begannen im Royal Bunker. Dem Freestyle-Treff und Rap-Trainingslager, eher Ballermann als Body Rock, ein Rap-Sportheim mit Schmuddel-Charme, im Keller, unten, Untergrund. Einfach eine abgefuckte Kneipe, wo sich niemand zu Hip-Hop-Werten bekennen mussten, aber alle Bock auf Rap hatten. Entfernt mit dem kalifornischen Project Blowed als Vorbild. Und Savas als einem der ersten, der dort selbst für viele ein Vorbild wurde. Und hartem Rap Berliner Schule die Tür öffnete.
Viele folgten ihm dort hinaus. Einige schafften es wie er ins Rampenlicht. Die erstaunlichste Karriere legte wahrscheinlich Sido hin. Als Mitglied der Crew Die Sekte führte sein Weg vom Märkischen Viertel in den Royal Bunker. Von dort aus flexte er weiter an Deutschraps Kehrtwende. Und ließ in die versiffteren Gemächer von Raps Reihenhaus blicken.
Im Vergleich zu Savas‘ hochtechnischen Rap-Skills bestand Sidos Verdienst an der Deutschrap-Front vielmehr darin, einen Hartz-IV-Jargon ins Game zu bringen, die Haltung der Abgehängten, den explorativen Trash-Chic vom Nachmittagsprogramm der Privatsender. Auf diese Weise machte er auch jene zu Fans, die von den etablierten MCs ignoriert oder belächelt wurden.
Love Parade und Lotterleben, dabei rappen, weil man’s geil findet: Sido stellte das lässig und undogmatisch auf die Bühne – und ebenso charmant wie souverän ins Fernsehen. Er drängte förmlich in die Studios, beherrschte schnell MTVs TRL-Shows, fuhr schließlich bekifft dem Stefan Raab seinen Wok. Und mauserte sich zum Ganoven der Herzen. Natürlich trug seine berühmte Maske gehörigen Anteil an seiner stetig wachsenden Prominenz. Aber Thomas D hatte schon Recht, als er 2005 bei der Echo-Verleihung erklärte, sein Preis gebühre eigentlich Sido.Auf diese Weise machte er auch jene zu Fans, die von den etablierten MCs ignoriert oder belächelt wurden.
Inzwischen hat er den Echo. Zweimal. Mama war schon vorher stolz. Heute wohl umso mehr, denn Sido ist Popstar. Einer der größten, den Deutschrap hervorgebracht hat. »Alt und grau im MV« ist er nicht geworden, wie einst in »Mein Block« prophezeit, der Single, die seine Karriere initiierte.

Als sie heuer auf dem Splash! Festival ein gemeinsames Album ankündigten, war das mehr als eine kleine Sensation. Es hatte einfach keiner damit gerechnet, haben sie stilistisch doch kaum Berührungspunkte. Nun aber kommt es raus. Betitelt auf »Royal Bunker«, auf den Ort, wo sie sich 1998 zum ersten Mal trafen. Und dessen Keller-Chic sie als Deutschrap-Superstars längst entronnen sind.