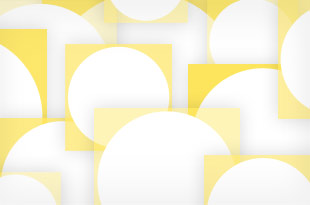Rap ist viel zu ernst. In diesem Genre, das entweder von überzeichneten Männlichkeitsaposteln dominiert oder von halblustigen Rucksackträgern karikiert wird, gibt es kaum Luft zwischen diesen beiden Gegensätzen. Nur wenigen Musikerinnen und Musikern auf diesem Gebiet ist es gleich, ob eine über allem stehende Botschaft nach außen getragen wird, ob sie die Welt zu einem besseren Ort machen können und so weiter, anstatt »L’art pour l’art«, also die Kunst um der Kunst willen, walten zu lassen. Es wird meist darauf verzichtet, mit Worten und entsprechenden Konstruktionen oder einer Musikalität außerhalb der in diesem Genre sehr strikten Vorgaben zu experimentieren. Sehr schnell ist es dann »nicht mehr Rap«, wie man z.B. auch in der Diskussion um Caspers neues Album erleben kann. Umso schöner ist es dann doch zu sehen, wenn einer, der mit »Rap-Legende« bei weitem nicht hinlänglich beschrieben ist und »realer« kaum sein könnte, sich seit Jahren bemüht, auch dem künstlerischen Aspekt in diesem Genre eine Stimme zu geben. Die Rede ist von Kool Keith und seinen unzähligen Alter Egos, die er zu seinem Konzert ins Berliner Gretchen mitgebracht hatte. Das ehemalige Mitglied der Ultramagnetic MCs, inzwischen 46 Jahre alt, hob mit dem Konzept für seinen Gig in einem mehr als vollen Haus die übliche Struktur aus den Angeln und spielte statt ganzer Songs bloß nacheinander die Refrains seiner Alben und demonstrierte dem Publikum so die Beliebigkeit seiner Texte. Das hatte wilde Szenen im Pulk vor der Bühne zur Folge, das sich von Hit zu Hit immer weiter einem Adrelaninschock entgegenschwang, der schließlich in munterem Pogo mündete, wie man ihn nicht mal bei Punk-Shows zu sehen bekommt. Selbst ein Security sprang beim wilden Getümmel in die Menge, um etwaige Stressmacher rauszuziehen – erfolglos. Stattdessen sprang nach Kool Keiths Aufforderung Retrogott für eine Freestyle-Session zurück auf die Bühne, der bereits mit Hulk Hodn im Vorprogramm zu sehen war. Ähnlich diffus wie sein Bruder im Geiste haute der selbstironische Kölner dilettantische Punchlines ins Mikrofon, die sich vielleicht nicht jeder im Publikum erschließen konnte, über die aber viele herzlich gelacht haben. Das machte den entscheidenden Unterschied zu vielen anderen Rap-Shows: Es ging um die Kunst und die Ausführung dieser und weniger um die Bedienung von Klischees oder ihre Erfüllung auf Nachfrage – auch wenn es »Girl Let Me Touch You« am Ende trotzdem gab. Muss ja.

Retrogott & Hulk Hodn – Gesprächsfetzenkontamination
Porträt