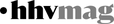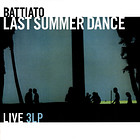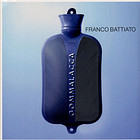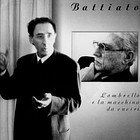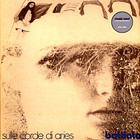Der Weg in die wundersame Welt von Franco Battiato führt nachgerade durch sein religiöses Selbstverständnis. In einem Interview mit der taz bejahte der italienische Megastar die Frage, ob er Buddhist sei, mit Nachdruck – und wies sich dann noch als Hindu, Christ, Jude, Sufi und vieles mehr aus. Der spirituelle Synkretismus des Komponisten, Cantautore (Singer/Songwriter), Plattenproduzenten, Filmemachers und Malers spiegelt sein Schaffen als hyperproduktiver Künstler wider, der gleichermaßen Nurse With Wound, Karlheinz Stockhausen und die italienische Öffentlichkeit für sich gewann und kitschige Liebeslieder, bahnbrechende Prog-Rock-Platten, überschwänglicher Avantgarde-Alben und einige der langlebigsten Pop-Hits der italienischen Geschichte veröffentlichte.
Battiato wurde am 23. März 1945 als Sohn eines Fischers und einer Schneiderin in Sizilien geboren. Nach dem Tod seines Vaters zog er 1964 zunächst nach Rom und dann weiter nach Mailand. Dort versuchte er, sich mit einer Gitarre und einer Auswahl an »pseudobarocker, fingierter ethnischer Musik« einen Namen zu machen. Es reichte aus, um das Interesse der Musikindustrie zu wecken, und 1965 debütierte Battiato auf Schallplatte. Auf seinen ersten Veröffentlichungen coverte er rührselige Liebeslieder, bevor er im Jahr 1967 mit der Single »La Torre« erstmals als (Ko-)Songwriter in Erscheinung trat. Zur gleichen Zeit gründete er das Duo Gli Ambulanti, mit dem er versuchte, sich als Protestsänger einen Namen zu machen. Er gab das Projekt schnell wieder auf und schlug nach seinem Vertragsabschluss bei Philips einen »romantischeren« Weg ein.
In den späten 1960er-Jahren konnte Battiato bescheidene Erfolge feiern und trat mit »La Torre« sogar in der beliebten Fernsehsendung Diamoci del tu auf, wo er die unbeholfenen Tanzbewegungen zur Schau stellte, die später zu seinem unfreiwilligen Markenzeichen werden sollten. Doch war es eine Zeit der Rückschläge. Im Jahr 1969 nahm er sein Debütalbum auf, dann jedoch wurde das Projekt auf Eis gelegt. Das führte zu einer Krise, die sich als produktive herausstellen sollte. »Ich begab mich auf die Suche nach anderen Musikgenres«, sagte er 2006 in einem Interview. »Ich stellte mir dabei eine elektronische Reise vor – obwohl ich nicht wirklich wusste, was elektronische Musik war.« Nachdem er vom Synthesizer EMS VCS 3 gelesen hatte, reiste er nach London, um zwei davon zu kaufen.
»Prog- und Avantgarde-Platten landeten in den Charts, Popmusik war verboten«
Fabio Zuffanti
Battiato hatte sich an den beiden großen Trends der mittleren bis späten 1960er-Jahre orientiert, kitschigen Pop hier und von Bob Dylan inspirierter Protestmusik dort. Bald jedoch fand er sich in der Lage, den Zeitgeist einzufangen, anstatt ihn einfach nur zu kopieren. Italien hatte gerade den so genannten Autunno Caldo erlebt, eine Reihe von Streiks in den nördlichen Industriezentren. Die aufkeimenden Sympathien für linke Politik und die gegenkulturelle Haltung jener Zeit wirkten sich auf die Kultur aus. »Prog- und Avantgarde-Platten landeten in den Charts, Popmusik war verboten«, so der Journalist und Battiato-Biograf Fabio Zuffanti. Gleichgesinnte fand Battiato im Umfeld des Labels Bla Bla, wo er erstmals als Mitglied der proggigen Hardrock-Band Osage Tribe Musik veröffentlichte.
Die 1970er-Jahre: Ein wunderschön-wildes Durcheinander
Battiatos Debütalbum »Fetus« (international: »Foetus«) auf Bla Bla ist nach wie vor außerhalb Italiens eine seiner bekanntesten Platten und gilt heute als frühes Meisterwerk der aufkeimenden Prog-Rock-Szene. Das Album ist von Aldous Huxleys dystopischem Roman »Brave New World« inspiriert und von Battiatos Affinität für den VCS 3 geprägt. Es verbindet Rock- und Pop-Songwriting mit einem anarchischen Ansatz, der wissenschaftliche Formeln, Aufnahmen des ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon und Stücke von Johann Sebastian Bach zusammenrührt – ein wunderschön-wildes Durcheinander, das die Avantgarde-Techniken der Musique Concrète mit Ideen aus der elektronischen und modernen Rockmusik verband. Und obendrein ein kommerzieller Flop.
Battiato ließ sich nicht beirren und im Folgejahr mit »Pollution« und »Sulle corde de Aries« zwei Platten ähnlicher Machart folgen. Mit ihnen etablierte er sich als Komponist, der sich zwischen konzeptuell anspruchsvoller Kunst und eingängiger Musik bewegte. Sie brachten ihm die Anerkennung von Nurse With Wound, die ihn 1979 in ihre legendäre Liste abenteuerlicher Künstler:innen und Alben aufnahmen; sogar Karlheinz Stockhausen konnte er für sich gewinnen. Nachdem er sein Album »Clic« aus dem Jahr 1974 dem deutschen Komponisten gewidmet hatte – der Battiato neben Kraftwerk als eine der beiden Acts im Bereich der Popularmusik nannte, die er interessant fand –, besucht der Italiener Stockhausen in Kürten. »Er drückte mir eine Partitur in die Hand und sagte: ›Hier, sing das‹, aber ich konnte ja gar keine Noten lesen.«
Das unangenehme Aufeinandertreffen veranlasste den Autodidakten, Musiktheorie und Komposition zu studieren, und nur drei Jahre später gewann er einen nach Stockhausen benannten Preis für sein achtes Soloalbum »L‘Egitto prima delle sabbie«. Doch Battiatos Geschichte verlief einmal mehr nicht geradlinig. Noch während er Platten produzierte, die klangen, als hätte man Tangerine Dream für ein paar durchzechte Nächte Zutritt zum Kölner Studio für Elektronische Musik verschafft, war er im Bereich der Rock- und Popmusik aktiv. Als Mitglied von Telaio Magnetico machte er dröhnenden Psych-Rock, der wie eine Kreuzung aus den Taj Mahal Travellers, den Master Musicians of Jajouka und den frühen Pink Floyd klang, bevor er sich auf seiner einzigen Single unter dem Pseudonym Astra 1978 dem Art-Rock zuwandte.
Damit kündigte sich ein weiterer Stilwechsel oder vielmehr die neuen Prioritäten in Battiatos Schaffen als Komponist und Musiker an. Sein im Jahr 1979 erschienenes Album »L‘era del cinghiale bianco« löste ihm zufolge einen »Skandal« aus – das hier war die Rockmusik, von der er sich mit jedem seiner Soloalben immer weiter entfernt zu haben schien. Es wurde sein erster großer kommerzieller Erfolg. Fast eineinhalb Jahrzehnte, nachdem er im Musikgeschäft einsteigen wollte, wurde Battiato endlich beachtet. Und hatte keinen Spaß daran. »Mit dem Erfolg kamen die Fans: Eines Nachts wachte ich in einem Hotel auf und stellte fest, dass sie Leute in mein Zimmer gelassen hatten, die mich beim Schlafen beobachteten. Ich wollte aufhören.« Er tat es nicht und wurde stattdessen noch berühmter.
Die 1980er Jahre: Alles oder nichts
Franco Battiato stieg mit zwei Alben zum Megastar auf, die den Beginn einer neuen Ära vertonten. Ab dem Jahr 1968 wurde Italien während der sogenannten Anni di piombo immer tiefer ins Chaos gestürzt, weil politische Gewalttaten und Terrorismus von links- und rechtsradikalen Organisationen zunehmend den Alltag beherrschten. Was aber tat Battiato? Er brachte ein Album mit dem zweideutigen Titel »Patriots« heraus, auf dem ein Lied über das Leben in Sowjetrussland zu hören war. Tatsächlich blieb Battiatos politische Haltung zeitlebens so undurchsichtig wie seine spirituellen Neigungen – er war offensichtlich kein Freund der Konsumgesellschaft und unterstützte gelegentlich linke Bewegungen, wurde aber ebenso für die angebliche Verbreitung rechten Gedankenguts kritisiert.
»Mir schrieb eine Fünfzehnjährige, dass es ihr egal sei, was ich sage, dass sie es trotzdem liebt. Das ist wunderbar, denn ich will ja nichts sagen, oder alles.«
Franco Battiato
Dass Battiato politisch und auch sonst schwer einzuordnen war, wurde zu einem der bestimmenden Merkmale seiner Musik, die auf seinem 1981 erschienenen Hit-Album »La voce del padrone« umso referenzreicher wurde. Die Leadsingle »Bandiera bianca« leiht sich ihren Titel von einem Gedicht von Arnaldo Fusinato über die Kapitulation Venedigs vor dem österreichischen Kaiserreich während des ersten italienischen Unabhängigkeitskrieges und zitiert Bob Dylan, Theodor W. Adorno und The Doors. Der renaissance man Battiato wurde – zwei Jahre, nachdem Jean-François Lyotard den Begriff geprägt hatte – zum Postmodernisten. In seinen Worten: »Mir schrieb eine Fünfzehnjährige, dass es ihr egal sei, was ich sage, dass sie es trotzdem liebt. Das ist wunderbar, denn ich will ja nichts sagen, oder alles.«
Für Battiato waren die 1980er-Jahre von seiner langfristigen Kollaboration mit dem Komponisten Giusto Pio sowie von seiner eigenen Arbeit als Songwriter für die Sängerin Alice geprägt, mit der er 1984 auch am Grand Prix Eurovision de la Chanson teilnahm. Nachdem er bereits Platten für Künstler wie Raul Lovisoni und Francesco Messina sowie Michele Fedrigotti und Danilo Lorenzini produziert hatte, arbeitete Battiato mit dem italienischen Superstar Milva an zwei Alben und verdingte sich ebenso als Regisseur seiner eigenen Musikvideos, während er sich weiter in die Theorien von G. I. Gurdjieff, die Lehren der Sufi-Mystik und die arabische Sprache vertiefte – und nebenbei noch ein Leben als einer der beliebtesten und kommerziell erfolgreichsten Cantautor‘ führte.

Der Einfluss Battiatos in Italien lässt sich nicht überbewerten. Wer bei sommerlichen Temperaturen das Radio einschaltet, wird nach ein paar Minuten unweigerlich »Cuccurucucù« zu hören bekommen. Schwieriger fällt es da, Außenstehenden seine Anziehungskraft zu erklären. Denn Battiato war kein guter Sänger und definitiv ein ungelenker Tänzer, so jemand, der Nietzsche in Popsongs erwähnte und im Allgemeinen die Art von eklektischer, einfallsreicher und unkonventioneller Musik machte, die in den Führungsetagen von Plattenfirmen verachtet wird und ihr Publikum verunsichert. Doch selbst Experimente an der Schnittstelle von klassischer Musik und Pop wie »Fisiognomica« sorgten landesweit für Begeisterung. Bald wurde Battiato nur noch Il Maestro genannt, der Meister.
Nach den 1980er Jahren: Alles auf einmal, in jedem Moment
In den folgenden Jahrzehnten betätigte sich Battiato als Maler, kollaborierte mit dem Philosophen Manlio Sgalambro als seinem Texter und bewegte sich weiterhin nahtlos zwischen klassischen und avantgardistischen Idiomen und den Strukturen der Popmusik, wenn er nicht beides miteinander synthetisierte. Die Rockballade »La cura« wurde im Jahr 1997 ein weiterer Megahit, nur drei Jahre später indes setzte er seinem Publikum mit »Campi magnetici« ein Album vor, das Breakbeats, Noise, Operngesang und Chanson zusammenbrachte. Überdies debütierte er als Filmemacher mit dem autobiografischen Drama »Perdutoamor«, bevor sein zweiter Film die letzten Jahre Ludwig van Beethovens in Blick nahm. In der Hauptrolle: Alejandro Jodorowsky, der Regisseur von »Holy Mountain«.
Nach einer Reihe von Cover-Alben – der falsch nummerierten »Fleurs«-Serie – sowie seltener Studioalben mit Originalen wie »Apriti sesamo« im Jahr 2013 spielte Battiato sein letztes Konzert im Jahr 2017, ein halbes Jahrhundert, nachdem er erstmals die Bühne betreten hatte. »Torneremo ancora« (»Wir kommen noch einmal zurück«), eine vom Maestro mit dem Royal Philharmonic Concert Orchestra eingespielte Sammlung einiger seiner größten Hits, erschien als sein letztes Album im Jahr 2019. Battiato starb zwei Monate nach seinem 76. Geburtstag im Mai 2021 in Sizilien. Zwei befreundete katholische Priester führten die Trauerfeier an – was aber wohl kaum bedeutet, dass er nicht bis zuletzt auch Buddhist, Hindu, Christ, Jude, Sufi und vieles mehr war. Battiato war doch alles auf einmal, in jedem Moment.