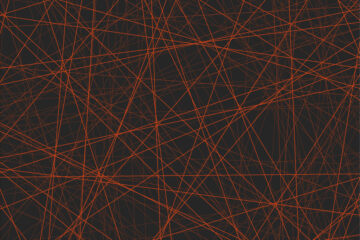Schon der Titel ist ein Rätsel, weil er wenig Informationen in sich trägt und doch viel auszusagen scheint: »Loop-Finding-Jazz-Records«, komplett duchgekoppelt und also eigentlich als eigenständiger Begriff zu lesen – was soll das heißen? Welchen Loop finden bitteschön welche Jazz-Platten und warum überhaupt haben sie sich auf die Suche gemacht? Oder soll es soviel heißen wie dass da jemand – Jan Jelinek wohl – dabei ist, einen Loop zu finden und der Jazz es aufzeichnet, Notiz davon nimmt? Handelt es sich wiederum vielleicht doch um eine elliptische Aufzählung: Loop, Finding, Jazz, Records? Und was hat diese durchaus Loop-basierte Musik überhaupt mit Jazz zu tun, wenn darauf kein erkennbarer Drum-Break, kein ikonisches Saxofon-Lick zu hören ist? Das alles ist auf den ersten Blick nicht ganz eindeutig oder einleuchtend, weil die Begriffe einander zu überlagern scheinen und somit auf semantischer Ebene einen Effekt bewirken, der aus dem optischen Bereich stammt und zwei – seit einem um die beiden B-Seiten der Vorab-EP »Tendency« erweiterten Reissues des Albums im Jahr 2017 nunmehr drei – der Tracks ihren Titel leiht: Moiré.
Moiré-Effekte, wie einer auch auf dem recht schlichten Artwork des Anfang Februar 2001 erschienenen Albums zumindest angedeutet wird, entstehen dadurch, dass einzelne Raster übereinander gelegt werden und neue Strukturen erkennbar werden. Das wiederum ist eben eine Methodik, die auch Jelinek auf seinem ersten Album unter seinem Klarnamen verfolgte, dem ab dem Jahr 1998 einige EPs unter dem Pseudonym Farben auf Klang Elektronik sowie das Album »Personal Rock« als Gramm vorausgingen. Schon die dachten Techno eher im Sinne eines Pole als minimalistisches Template nämlich, auf dem mit den Qualitäten von Sound experimentiert werden kann, um aus den Überlagerungen von Beat und Sound den Groove zu destillieren. Schluckauf-Sounds, Klangpatina, Störgeräusche, kratzige Mini-Samples, eine Menge Clicks und immer wieder Cuts, Cuts, Cuts organisierten sich um butterweiche Basslines oder bouncige Grooves, ergaben neue Muster und verliehen einander darüber eine sonderbare Unwucht. Nur konsequent von jemandem, der in einer Auflistung seiner Lieblingsplatten Eric Dolphy neben Terrence Dixon stellt und »3 Feet High and Rising« als die Platte seiner Jugend apostrophiert
»Loop-finding-jazz-records« stand definitiv in der Tradition dieser noch weitestgehend clubaffinen Releases aus Jan Jelineks Frühphase. Doch hatten die acht (beziehungsweise zehn) musikalischen Moiré-Raster, die Jelinek im Miteinander von Dance-Abstraktionen und Jazz-Samples am ASR10-Sampler collagierte, deutlich an Drive verloren und stattdessen an Dichte gewonnen. Selbst die straightesten Tracks des Albums, das dubbige »Rock in the Video Age«, »They, Them« und »Tendency« mit seinem zackigen Microhouse-Groove, sind im Gesamten betrachtet verhaltensunauffällig oder zumindest weniger auf Körperlichkeit denn auf auditive Stimulation ausgerichtet: Der Groove wird zum intellektuellen Erlebnis. »Manche Elemente tauchen da auf, wo sie es nicht sollten, aber nachdem man sich das Ganze ein paar Mal angehört hat, steht alles an seinem Platz. Und nach einer Weile fangen Sie selbst an, den Rhythmus und die ganze Komposition im Chaos der Töne nachzuzeichnen«, fasste Jelinek seine Absichten rückblickend in einem Interview zusammen.
In einer Zeit, in der DJs sich wie Rockstars gerierten, hing Jelinek das Ego wieder an den Nagel und ließ den Loops ihren Lauf.
Denn schließlich nahm er sich auch dezidiert nicht etwa direkt erkennbare Samples als Grundlage für seine Produktionen, sondern stark abstrahierte Sounds von Jazz-Platten, die als Loop in absolut fremde Kontexte eingebettet werden. »Jazz hat einen bestimmten Klang… Es ist nicht einfach nur ein Genre, das als Improvisation beschrieben werden kann«, sagte Jelinek gegenüber einem Online-Magazin wenige Monate nach Veröffentlichung des Albums. »Ein ungefiltertes Sample von einer Jazz-Platte auf einem Hip-Hop-Track ist als solches zu erkennen, obwohl das Sample selbst nicht die Improvisationen der Beteiligten abbildet.« Wie später auch auf Alben wie »Kosmischer Pitch« und »Zwischen« rückte Jelinek beim Sampling also den Fokus auf die scheinbaren Nebeneffekte von Musik. Das wiederum verlieh seinen eigenen Tracks eine sonderbare Anziehungskraft.
Auf Stücken wie »Them, Their« ist kaum erkennbar, ob die Basstöne primär als Beat oder doch als Melodie eingesetzt werden sollen – weil sie beides sind. Das passiert durchaus im Sinne von Techno und House, zehrt sich aber eben aus den Klangqualitäten von Jazz-Platten, die trotz der deutlichen Verbindungslinien zwischen beiden Genres einem anderen Prinzip verpflichtet sind – Virtuosität, Vitalität, Vibe. Auch die meisten der Klangflächen, die statisch über den Grundstrukturen zu schweben scheinen und sich doch ihren verspulten Bewegungen angleichen wie eine Nebelbank im Wind, stellen weder nur Rauschen noch allein Harmonie dar, sondern beides zugleich. Jelinek macht das Dazwischen und das Gegeneinander beider Ansätze hörbar, indem er sie loopt und stellenweise nicht synchron miteinander laufen lässt. Das Ergebnis sind Moiré-Effekte nicht nur klanglicher Natur. »Loop-finding-jazz-records« problematisiert in Stein gemeißelte Kategorien und fixe Dichotomien, in dem es sie dynamisch ineinander laufen lässt.
Ähnliches lässt sich auch über den Zeitgeist eines Albums sagen, das nicht zu altern scheint, weil es Zeitlichkeit nicht als eindimensional anerkennt. Indem Jelinek sich auf das Archiv stützte, um seine Klänge mit zeitgenössischen Sounds zu überlagern, hebelte er auch ein Stück weit die Gegenwart aus den Fugen. Derweil sich andere Vertreter*innen der sogenannten Clicks-&-Cuts-Sounds aus dem Umfeld von Labels wie Mille Plateaux, raster-noton oder Poles Label ~scape – wo auch »Loop-finding-jazz-records« erschien – sich Techniken des Samplings, Methoden des Dubs und technologische Störanfälligkeit oder Überfülle dafür zu eigen machten, um daraus dezidiert aseptische und futuristische Musik zu konstruieren, die nicht selten der Gegenwart ihre eigene Blauäugigkeit gegenüber jeglicher Technik vorhielt, sind Jelineks Klangentwürfe sanft und sinnlich, weil sie sich auf Kontinuitäten und Bruchstellen in der Musikgeschichte einlassen. Auf »Loop-finding-jazz-records« wird Jazz nicht im postmodernen Sinne als »toter Stil« wiederbelebt oder rein intellektualisiert – sondern auf eine sehr lebendige Art erfahrbar gemacht, die der Tradition der Jazz-Erfahrung etwas völlig Neues hinzufügt und dabei nicht einmal nach Jazz klingt. Ein musikhistorischer Moiré-Effekt. So verschwimmen die historischen Kausalitäten auf »Loop-finding-jazz-records« just zu einem Zeitpunkt, als die ein Jahrzehnt später von Simon Reynolds diagnostizierte »Retromania« der Popkultur ihren Anlauf nimmt.
Rückblickend lässt sich Jelineks Ansatz ebenso als Kommentar auf den sich rapide ausbreitenden Geniekult in der elektronischen Musik der Jahrtausendwende beziehen: In einer Zeit, in der DJs sich wie Rockstars gerierten, hing Jelinek das Ego wieder an den Nagel und ließ den Loops ihren Lauf. Als »Alchemie« bezeichnet er eben jene Arbeit nicht ohne Grund, als »auf Synergie begründet, wie eine chemische Reaktion«. Etwas also, das nicht ausschließlich dem Willen ihres Urhebers, sondern manchmal ganz eigenen Regeln und Dynamiken folgt: »Loop-Finding-Jazz-Records«.