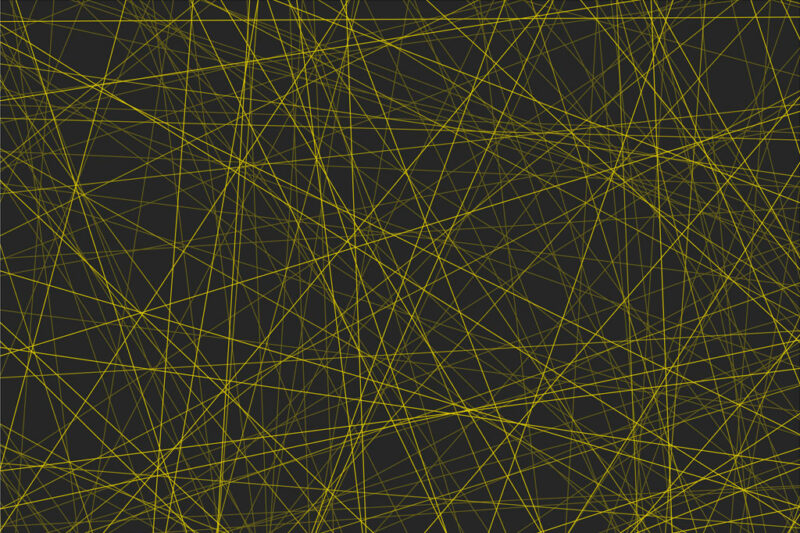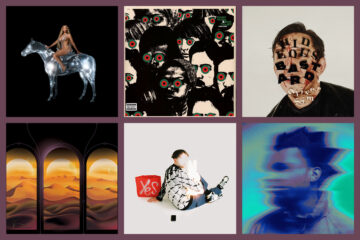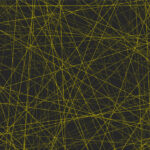 Im Frühjahr 2016 bewarben zahlreiche Plakate überall in Berlin ein Album, das es niemals geben sollte. Jetzt, da das Jahr zuende geht, sind sie nicht mehr zu sehen, wurden von anderen Postern überklebt. Unter zentimeterdicken Schichten von bunt bedrucktem Papier sind aber noch in Frakturschrift geschwungenen Erinnerungen daran vorhanden, dass es einmal ein Album namens »Views From The 6« hätte geben sollen. Das Marketing kam aber nicht dem Vermarkteten hinterher, Drake entschloss sich für den Hashtag-freundlicheren Titel »VIEWS«. Das Album erschien am 29. April online, die CD- und Vinyl-Versionen folgten erst einige Monate und zahllose Memes später. Abkassiert wird mittlerweile immer erst zum Schluss.
Im Frühjahr 2016 bewarben zahlreiche Plakate überall in Berlin ein Album, das es niemals geben sollte. Jetzt, da das Jahr zuende geht, sind sie nicht mehr zu sehen, wurden von anderen Postern überklebt. Unter zentimeterdicken Schichten von bunt bedrucktem Papier sind aber noch in Frakturschrift geschwungenen Erinnerungen daran vorhanden, dass es einmal ein Album namens »Views From The 6« hätte geben sollen. Das Marketing kam aber nicht dem Vermarkteten hinterher, Drake entschloss sich für den Hashtag-freundlicheren Titel »VIEWS«. Das Album erschien am 29. April online, die CD- und Vinyl-Versionen folgten erst einige Monate und zahllose Memes später. Abkassiert wird mittlerweile immer erst zum Schluss.
Im Jahr 2016 wurden viele Alben gefeiert, während das Albumformat langsam dahin schmolz und uns zwischen den Fingern verronn. Mit »Pet Sounds« von The Beach Boys und »Revolver« von den Beatles feierten zwei LPs ihren 50. Geburtstag, die das Format als solches erst überhaupt definiert hatten: Die gute Dreiviertelstunde Spielzeit pro Platte, welche vom Vinylformat vorgegeben wurde, wurde zum Raum für musikalische Narrative. Die Tage der LP als Sammelbecken für eine heterogene Menge möglichst erfolgreicher Songs wurde so Geschichte. Die Idee von der dreiviertelstündigen Erzählung mit Anfang (Intro), Mitte (Song 6, die Hit-Single) und Ende (die Ballade) rettete sich selbst ins CD-Zeitalter herüber, wo mit gut 73 Minuten – festgesetzt nach der Dauer von Beethovens Neunter Sinfonie – wesentlich mehr Zeit gegeben war. Nicht nur das, denn dank neuer technischer Gegebenheiten bot die CD sogar Platz für multimediales Zusatzmaterial wie Videos, Fotos oder sogar Computerspiele erlaubten. Trotzdem: Album blieb Album blieb Album. Vor allem, weil sich damit am besten Geld machen lässt.
Musik auf Tortillas
Doch im zurückliegenden Jahr war es nicht immer so leicht, überhaupt von Alben zu sprechen. Die von James Blake oder Radiohead aber? Ja, das waren Alben im klassischen Format – auch wenn hier ebenso digital vorgeschossen und physisch (CD, LP, viel später die limitierte Vinyl-Edition) nachgelegt wurde. Während ein Poster schnell hinter Dutzend anderen verschwindet, droht eine CD-Produktion noch schneller in Leaks zu resultieren als die Pressen rotieren. ###CITI:Das Promo-Poster mag verbleichen, die Deluxe-Box aber täuscht die Unvergänglichkeit eines großen Kunstwerks vor.:### Soll heißen: Die großen Players des Musikgeschäfts veröffentlichen aus finanziellen Selbstschutzgründen zuerst von einer auf die anderen Sekunde digital und liefern deshalb physische Exemplare nach, um den Objektfetisch ihrer Kundschaft zu befriedigen. Radiohead etwa legten der limitierten Sonderedition von »A Moon Shaped Pool« jeweils ein Stück alter Mastertapes bei. Wer sich eine kaufte, kam so noch näher ans Original, sprich das Album in seinem eigentlichen Format dran – und konnte die gut einen Zentimeter breiten Bänder doch nicht ohne Weiteres abspielen. Die Metapher drängt sich geradezu auf: Genießen lässt sich die Musik von Radiohead nur als großes Ganzes, nicht aber in Einzelteilen.
Das Album rettet sich so in eine Zeit herüber, in welcher sein Format längst obsolet geworden ist. Das Promo-Poster mag verbleichen, die Deluxe-Box aber täuscht die Unvergänglichkeit eines großen Kunstwerks vor. In das Design der Vinyl-Version von David Bowies »Blackstar« etwa wurden Raffinessen wie fluoreszierende Sternchen und, allerhand grafischer Schnickschnack eben eingearbeitet, welche die hartgesottene Fanbase erst über Monate nach und nach entdeckte. Ein kleiner Schimmer von Gesamtkunstwerk wurde so über ein ziemlich profanes, in eine Papphülle eingepasstes Stück Polyvinylchlorid gelegt und musste in einer Art ästhetischer Schnitzeljagd freigelegt werden. Die Zielgruppe wird am Spieltrieb gepackt.
Andere persiflierten diesen merkwürdigen Objektfetischismus, wie etwa Mathew Herbert Der britische Produzent veröffentlichte ebenfalls im Frühjahr durchaus abspielbare Platte in Kleinstauflagen, die allerdings keine große Halbwertszeit hatten: Er schnitt per Laserverfahren Musik auf Tortillas, Käse oder Auberginen. ###CITI:Sobald wir eine Platte anfassen, spüren wir uns auch, fühlen uns weniger entfremdet.:### Ein künstlerischer Kommentar auf Nahrungsmittelproduktion in der kapitalistischen Wohlstandsgesellschaft einerseits, eine implizite Kritik am Hype der Formatvielfalt andererseits. Tape, CD, Vinyl – eigentlich sind alle Abspielmedien überflüssig geworden und trotzdem schreiben wir ihnen mehr Wert zu als Grundnahrungsmitteln. Der rechnet sich aus der physischen Erfahrung und deren psychologischen Folgen zusammen: Sobald wir eine Platte anfassen, spüren wir uns auch, fühlen uns weniger entfremdet als wenn wir uns etwa durch YouTube klicken würden. Insbesondere Vinyl ist aber auch zum Deko- und Luxusobjekt geworden, das durch Inhalt (der Ambient-Techno von Gas etwa) und Format (eine massive 10-fach-Vinyl-Box) gleichermaßen Geschmack transportiert.
Schlag zu oder bereu es für immer!
Den perfekten Kompromiss zwischen Musik als Ware und Tonträger als übersteigertem Konsumobjekt lieferte im Herbst DΔWN mit ihrem Album »REDEMPTION«, welches in seiner limitierten Edition als USB-Stick daherkam, welcher in ein Halsband eingefasst war. Die Musik wird digital verfügbar gemacht, das Medium kann als modisches Accessoire verwendet werden. Weiter noch ist es möglich, den USB-Stick zu entladen und anderweitig aufzufüllen. Statt des DΔWN-Albums könnten genauso gut die Steuerunterlagen auf dem Stick ums Schlüsselbein baumeln. Auch das ein kleiner Subversionsakt im Krieg der Formate zwischen Gesamtkunstwerk und neuen Medienrealitäten.
Das physische Format stellt immer eine Limitierung dar, und das nicht nur eine zeitliche wie etwa bei der 45-minütigen LP. Egal, was nun auf einer Platte des sich in Anonymität hüllenden Produzentens Traumprinz alias DJ Metatron alias Prince Of Denmark zu hören ist: Der Store seines Labels Giegling wird überrannt, wenn darin eine neue 12” oder, wie Ende November, sogar eine 8-fach-LP zu finden ist. Ein Hauch von Exklusivität sichert sich das Label allein schon mit der grafischen Gestaltung der Vorab-Versionen, die im Falle von DJ Metatrons »2 The Sky« von Kindern handbemalt wurden. Es sind Platten, die schon kurz nach Pre-Order-Ende für bizarre Beträge weiterverhandelt werden. Um die Musik, wurde geklagt, ginge es schon gar nicht mehr. Das Label, so lauten die Vorwürfe, macht durch eine Verknappungsstrategie fetten Reibach. Das aber ist eben die Misere der langsamen Auflösung der Formate: Theoretisch braucht niemand eine Deluxe-Edition von Radiohead oder eine limitierte Traumprinz-12”. Die Musik ließe sich rein digital genauso genießen. Der Vinylfetisch des Publikums aber wird zum ultimativen Verkaufsargument, die Verknappung sorgt geradezu für Panik: Wenn’s weg ist, ist’s weg – schlag zu oder bereu es für immer! So lässt sich Kohle machen, die via Spotify auch nach tausenden von Plays nicht einzunehmen wäre.
DJ Metatron ist das Rave-Nostalgie-Pseudonym des Produzenten, dessen Öffenlichkeitsvermeidung sich ebenso mit dem althergebrachten Ideal des faceless Techno erklären könnte. Luke Slater der dieses Jahr als The 7th Plain mit recht ähnlich verträumten Sounds aus einer Zeitspanne von gut 20 Jahren Produktionsarbeit zurückkehrte, widmete sich unter seinem Hauptmoniker Planetary Assault Systems einem Erzählbogen. ###CITI:Die »Track ID Anyone?«-Crew muss allein klarkommen.:###
»Arc Angel« beginnt in der digitalen Version mit dem Klackern und Rumpeln eines Kassettenspielers, der zu anfänglichen Techno-Zeiten eines der wichtigsten Aufnahme- und Wiedergabegeräte des Undergrounds war: Mixe wurden aufgenommen, getauscht, zirkulierten per Post. Heute aber ist Slater so frei in seinen Entscheidungen, dass er der Vinyl-Version – die ohne das Intro auskommt – gleich das gesamte Album als fertigen DJ-Mix beigeben kann. Techno als Gesamtkunstwerk, die Technik macht’s endlich möglich. Jedes Format wird optimal genutzt und alle bekommen am Ende das, was sie wollen. Der bloße Rückgriff aufs Kassettenformat beweist, dass es sich längst überlebt hat. So wird das Album als solches bei Slater ähnlich flexibel, wie es der USB-Stick-Anhänger von DΔWN als physisches Objekt ist.
Zomby ist ähnlich rückwärtsgewandt wie DJ Metatron, bezieht seine Inspiration aber aus einer anderen Subkultur und reflektiert mit seinen erratischen Alben ganz andere mediale Gegebenheiten. Was für Slater der Kassettenrekorder ist, das sind für den vermutlich um 1980 geborenen Zomby – der ironischer Weise mit seinem ersten Album die Frage »Where Were U In ‘92?« aufwarf – die Rips aus den Pirate Radios des britischen Hardcore Continuums. Auch sein neues Album »Ultra« lässt Tracks in medias res anfangen und aufhören. Zomby kümmert sich nicht um klassische Track-Strukturen, erst recht aber interessiert ihn das Album als Format an sich keinen Deut. »Ultra« könnte eine Sammlung von Radio-Rips sein, wie sie heutzutage tausendfach im Netz kursieren: nicht mehr als eine YouTube-Playlist, lose aneinandergereiht und ohne zugrunde liegende Erzählung dahinter. Passend zu seiner distanzierten Haltung verbirgt Zomby sein Gesicht hinter einer Maske. Der Autor ist egal, erlebt wird die Musik im Augenblick. Die »Track ID Anyone?«-Crew muss allein klarkommen.
Pop als Diskursplattform“
Den Auf- und Ablösungserscheinungen des Albumformats sowie der zunehmenden Dezentralisierung musikalischer Produktionen stehen industrieweite Nischenkämpfe auf dem Musikmarkt und latente Personenkulte entgegen. Ein Album bringt rein rechnerisch am meisten ein, insbesondere sofern es auf nur einer Plattform erhältlich ist. TIDAL, Apple Music und Spotify etwa schlugen sich in diesem Jahr um Exclusives. Album X von Künstler_in Y, so die Hoffnung, wird schon ihre Zielgruppe auf Plattform Z bringen – und die Kohle gleich mit. Es bilden sich Monopole.
Nicht aber Plattformen allein, sondern auch Personen bündelten im Jahr 2016 die Aufmerksamkeit auf sich. Als Beyoncé im Januar mit »Formation« die Vorab-Single zu ihrem Album »LEMONADE« veröffentlichte, geschah das im Videoformat und triggerte eine schier endlose Debatte Worum es dabei so gut wie gar nicht ging: Musik. Was es aber bewirkte: Alle wollten mitreden können und umso mehr das komplette Album hören. Möglich war das zuerst nur auf TIDAL. Wie das vorige, selbstbetitelte Werk Beyoncés ging es in »LEMONADE« vor allem um die Person Beyoncé oder zumindest ihre öffentliche Persona, deren Image in der Zeit davor von Skandalen angekratzt wurde. Mit »LEMONADE« wurde eine mehr als ausgiebige Antwort auf die Frage geliefert, ob Jay Z denn wirklich fremdgegangen sei oder zumindest wird diese Erzählung mit »LEMONADE« aufgenommen und in eine klassische Struktur überführt, die eher dem Kübler-Ross-Modell als der klassischen griechischen Tragödie folgt. »LEMONADE« war allerdings noch weitaus mehr als das.
Hatte Holly Herndon noch im Vorjahr vorgeschlagen Pop als Trägersignal für politische Diskurse zu verwenden, lieferte Beyoncé jetzt die Super Bowl-kompatible Variante nach. Das funktionierte vor allem deswegen, weil »LEMONADE« schon kaum noch mit dem Titel Gesamtkunstwerk beizukommen wäre. Ein kurzzeitig kursierendes Vinyl-Bootleg etwa erzählte kaum die halbe Story, die ebenso auf ihre Bilder und vor allem – in den begleitenden Videos – zusätzlichen Texte, die den Kontext der einzelnen Stücke fest in einem Strom verankerten. In der Person Beyoncé Knowles kulminierten so eine Vielzahl von Diskursen, die viele Aussagen in Sachen race, Gender und Liebe zuließen. Indem sie ihr Album in jeglicher Hinsicht maximal verwertbar machte, konnte Beyoncé es zu einer Plattform in Herndons Sinne ausbauen. Die Exklusivität von »LEMONADE« garantierte ihr eine Freiheit, die nicht allein inhaltlich war. Beyoncé hat ein Gesamtkunstwerk geschaffen, wie es Radiohead-Fans höchstens als Schnipsel in ihren Deluxe-Boxen vorfanden.
Beyoncé oder Kendrick Lamar mit seinem dezidierten Nicht-Album »untitled unmastered« sind nicht die einzigen, die aus dem Hype um ihre Person Konsequenzen gezogen haben. Frank Ocean ließ seine Fans – grob geschätzt: alle mit zwei Ohren und einem Herzen – so lange auf einen Nachfolger von »Channel Orange« warten, dass die Warterei selbst memefiziert wurde. Dann, nach ein paar kryptischen Nachrichten, erschienen innerhalb kürzester Zeit gleich zwei… Alben? »Endless« zumindest war eher ein klassisches Anti-Album, mit dem der Künstler seine letzten Vertragsleistungen erbringen wollte, um daraufhin für immer Ruhe von Def Jam zu haben – es kam aber im Video-Format. Zu sehen war ein verdreifachter Ocean, der über 45 Minuten Holzboxen zusammenzimmert, um daraus eine Treppe zu bauen. Sollte heißen: So long, and thanks for all the fish. Heißt aber auch: Dieses Album ist eine Sammlung von provisorischen Modulen, die lediglich ihren Zweck erfüllen sollen. Tools im wahrsten Sinne des Wortes, wie sie etwa auf einem Techno-Album zu erwarten wären. Ocean aber ist kein Luke Slater, er hatte noch Größeres vor.
Am Tag drauf dann erschien ein Album, das wie die Drake-Platte einige Monate früher nicht den angekündigten Titel trug. »Boys Don’t Cry« stand lediglich auf den Magazinen geschrieben, die in Pop-Up-Stores anlässlich des Releases von »Blond« erhältlich waren, welches später dann als »Blonde« kanonisiert wurde. War »Endless« eine modulare Serviceleistung für die Plattenfirma, kam nun das eigentlich künstlerische Statement in Form eines Albums, das sein Format allein schon durch die widersprüchlichen Angaben des Titels zerfließen ließ. »Blond/e«, ebenfalls zuerst nur exklusiv über iTunes beziehungsweise Apple Music erhältlich, läuft gut eine Stunde durch wie ein klangliches Schaumbad, darüber vervielfacht sich Ocean stimmlich wie er das im vorab veröffentlichten Video-Anti-Album tat. Er kreischt, raunt, croont und singrappt gegen sich an. Auch das ist aber eher ein Kompromiss mit den musikindustriellen Sachzwängen, die zwar hinter ihren Geldquellen herhinken, sie aber doch immer einholen. Wenn ein Künstler sich nicht doch anmaßt, das Album als Format endgültig hinter sich verlassen.
Personenkult sells
Kanye West war schon immer ein megalomanischer Künstler, ein erratischer obendrein. Seine Twitter-Rants sind berüchtigt, über sie bildet sich aber auch seine künstlerische Persona aus. Über Twitter teaserte West auch über Monate ein Album an, dessen Name sich kontinuierlich änderte (aus »SWISH« wurde zuerst »Waves«, damit aber noch nicht genug) und welches dennoch das beste aller Zeiten sein sollte (Eigenaussage, eh klar). ###CITI: »The Life Of Pablo« ist kaum weniger als eine mediale Revolution.:### Über Soundcloud erschienen im Anthologie-Format der G.O.O.D. Fridays ein paar Teaser, irgendwann aber stand nicht nur das Cover, sondern auch die Tracklist des Albums fest, welches nun unter dem Titel »The Life Of Pablo« gehandelt wurde. Veröffentlicht wurde es am 14. Februar exklusiv über TIDAL und sollte laut West ausschließlich auf alle Zeiten nur dort erhältlich sein. Das zumindest versprach zuerst die größten Gewinnmargen, bevor sich West im Oktober dann selbst über den Beef zwischen TIDAL und Apple aufregte.
»The Life Of Pablo« hingegen kommentierte fortlaufend die Überfälligkeit des Albumformats an sich. West tauschte Songs durch alternative Versionen aus, veränderte die Tracklist oder nahm komplett neue Stücke auf. In einer (vorläufig) finalen Version zum Download angeboten wurde es erst am 1. April des Jahres, physische Veröffentlichungen waren nie vorgesehen. Im Grunde reflektiert diese wilde Veröffentlichungsstrategie lediglich die von Soundcloud-Artists, die ihr eigenes Werk ähnlich ständig aktualisieren können, bei einer Mainstream-Figur wie Kanye West allerdings handelte es sich um kaum weniger als eine mediale Revolution. Ein Album muss schon lange nicht mehr eine unveränderliche Einheit bilden, es kann sich progressiv im Laufe der Zeit (weiter-)entwickeln. Das Album ist grenzenlos geworden, es hat sein eigenes Format erfolgreich überwunden. Deutlich aber wurde das erst in diesem Jahr. Das wiederum bringt auch seine finanziellen Vorteile mit sich: Jede Änderung wurde als News verbreitet und drängte Wests Publikum dazu, sich das Album in seiner neuesten Form anzuhören. Personenkult sells.
»The Life Of Pablo«, »Blond/e«, und »LEMONADE« werden nicht ohne Weiteres als fette Vinyl-Reissues neu aufgelegt werden können, wie das in diesem Jahr mit Alben von Pink Floyd, Autechre, den Beatles, den Beach Boys, Gas und vielen anderen geschah. Sie positionieren sich viel näher am Puls der Zeit, welcher durch algorithmisch gesteuerte Streamingdienste gezeichnet ist. Wer heute ökonomisch geschickt taktieren will, muss zuerst aufmerksamkeitsökonomisch einiges leisten. Auf Twitter, auf tumblr, mit Videos oder auf Soundcloud. Das Album als 45-minütige konzeptionelle Einheit zerfließt in diesem Prozess und wird nur mit Müh und Not wieder in eine feste Form gebracht.
Das Album ist 2016 zum Zerrspiegel einer Musikindustrie geworden, die ähnlich wie Drake-Poster aus dem Frühjahr von gestern zu sein scheint. Zugleich aber zeigte sich auch eine neue Flexibilität, die neue künstlerische Möglichkeiten offenbarte. Vorbehalten waren die aber wieder auch nur denen, die ihr Monopol etablieren konnten, ob dieses sich nun in einer Traumprinz-12”, einem Beyoncé-Gesamtkunstwerk oder Frank Oceans Abschreibetaktiken offenbarten.
Jahresrückblicke 2016